"Wir haben den Handel in Andernach
belebt, doch die Bürger nehmen die
Galerie noch nicht wirklich an... Die
Laufkundschaft ist zu gering, das
habe ich nicht erwartet... Der Trend
wird sich langfristig umkehren, doch
es wird ein sehr zäher Prozess."
Das ehemalige Stadthaus und die Mälzerei Düsterwald und Tillmann (Foto oben) wurden 1977
für den Neubau des Horten-Kaufhauses abgerissen. Das Stadthaus, dem die jetzt eröffnete Galerie
ihren Namen verdankt, entstand 1841/42. Es beherbergte bis 1931 das Stiftsgymnasium, den
Vorläufer des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums. Sein Architekt war vermutlich Johann von Lassaulx,
der Begründer der rheinischen Neuromanik (er plante Kirchen, Rathäuser und den "modernen"
Königsstuhl in Rhens). Leider stand das Bauwerk nicht unter Denkmalschutz.
Das Horten-Kaufhaus (Foto unten) wurde 1979 eröffnet. In den 1990er-Jahren übernahm
Rupprecht das Warenhaus, musste aber wegen Insolvenz seiner Muttergesellschaft 2002 aufgeben.
Der Umbau des Gebäudes durch die Heine Bau AG aus Oberhausen - sie machte inzwischen
pleite, gehört jetzt zum österreichischen Porr-Konzern - zauberte die Stadthausgalerie hervor.
Fotos: Stadtmuseum






Heißt von Wuppertal lernen...
...von Wuppertal siegen lernen?
Es fragt sich aber, ob unsere Fußgängerzonen und überdachten Fußgängerzonen, sprich: Shopping-Malls,
so attraktiv sind wie ihre Pendants etwa in England oder Frankreich - Zweifel daran sind angebracht.
Seit dem epochalen Bruch der auch von aristokratischer Geschmackssicherheit geprägten Tradition
durch das Nazireich performen die Deutschen schlecht. Das betrifft die Architektur und den Städtebau
besonders, die den öffentlichen Raum nach 1945 so stark verhunzt haben wie in keinem anderen
europäischen Land. Die autogerechten, funktional entmischten, kaputtsanierten westdeutschen Städte
sind oft beklagt worden, ebenso die Betonsärge ihrer Warenhäuser und die immergleichen Konzepte
ihrer Einkaufszentren. Das wegweisend andere Konzept des CentrO in Oberhausen stammte von
britischen Experten. Auch der Umbau des Berliner KaDeWe liegt in der Hand ausländischer Architekten,
des O.M.A von Rem Koolhaas - offenbar sind wir nicht auf der Höhe der Zeit, was Trends des Event-
Shoppings und moderner Retail-Architektur angeht. Aktuell müssen Shopping-Center sich zu Freizeit-
und Unterhaltungsstätten wandeln, wollen sie gegen den Onlinehandel bestehen. Das bezweckt etwa der
von einem Briten geleitete Umbau der Potsdamer Platz Arkaden in Berlin. Dort will der US-Spielzeug-
hersteller Mattel eine Erlebniswelt für Groß und Klein ("Mission Play!") eröffnen - Berlin, nun freue dich!
(Tschuldigung, Herr Momper.)


"Kruzitürken, gibt's für Dinos
denn kein Altersheim?"
Schäm' dich, Kunde!
Stümperei trotz Wasserwand -
auf dem runderneuerten Dresdner
Postplatz geht alles andere als die
Post ab (s. unten). In einer der
ehedem schönsten deutschen Städte
fällt die aktuell grassierende städte-
bauliche Impotenz besonders auf.


Die "grüne Wiese" mit ihrem überlegenen Platzangebot und der 24/7 geöffnete Onlinehandel nehmen
den innerstädtischen Handel von zwei Seiten in die Zange. Daher drohen neu erbaute Einkaufsquartiere
in der Stadtmitte heute so überholt zu sein wie es die neu errichtete Festung Ehrenbreitstein in Koblenz
zu Beginn des 19. Jahrhunderts war. Mehr Gastronomie statt Handel dürfte keine Lösung sein; das macht
die Läden nicht attraktiver. Der Verkauf an Sonntagen ist durch die Ladenöffnungsgesetze strikt begrenzt.
Eine Internet-Plattform wie die Online City Wuppertal, auf der sich lokale Händler, Dienstleister und
Gastronomen gemeinsam präsentieren, zeigt einen Ausweg: Sie bringt E-Commerce und stationäres Ge-
werbe in einem Multi-Vendor-Shop zusammen ("Kauf an der Wupper, nicht am Amazonas"). Mit ihrem
digitalen Marktplatz war die Wuppertaler Geschäftswelt Vorreiter in Deutschland.
Vor allem in wenig prosperierenden Städten weichen Menschen auf den billigeren Onlinehandel aus; die
kleinen Läden ohne Internetpräsenz - immer noch die meisten - machen dicht, die Innenstädte veröden.
Stark sind die Innenstädte da, wo der Arbeitsmarkt stark ist. Wem es gut geht, der tut sich auch was Gutes.
Der shoppt auch um der Atmosphäre, der Events, der Kommunikation willen. E-Commerce hat kein Flair,
nur rund um die Uhr geöffnet. Unsere Lebenslust will sich nicht mit digitaler Convenience begnügen, wir
wollen nicht zu Datenspuren im Netz verkümmern. Am farbigen Pixel-Abglanz haben wir nicht das Leben.
Das Leben findet in der Beletage statt, das Internet in einem Blue-Light-Verlies, in einer Platonschen Höhle
ohne Ausgang und ohne Schatten. In ihr sind nur Gamer glücklich, die wissen: Unsere Maulwurf-Existenz
ist bloß ein Spiel. Sozial sein heißt am Leben sein, digital sein heißt hinter dem Leben her sein. Auch wer
sein Geld online macht, will es offline ausgeben. "Live Is Life", sang einst die Ösi-Band Opus.




Der Projektentwickler Rainer Molitor
in einer ersten Bilanz sechs Monate
nach der Eröffnung

Grau ist das Netz, farbig das Leben: Barbie kommt an den Potsdamer Platz. © Artist Concept Rendering
Oberbürgermeister Achim
Hütten reitet gern vorneweg.
Wie schwer wir Deutsche uns heute mit dem Städtebau tun, zeigt drastisch die Neugestaltung des
Postplatzes in Dresden nach einem Konzept, das bereits 1991, als die Verwaltung noch in den Kinderschuhen
steckte, siegreich aus einem Ideenwettbewerb hervorging. An diesem Vorschlag eines Professors für Stadt-
planung und gebürtigen Dresdners hält die sächsische Landeshauptstadt seitdem eisern fest. Resultat: Der
durchgehend versiegelte Platz ist nicht erlebbar - wo er geschlossen sein müsste, ist er offen (die Lücke
zwischen Theater und Zwingerforum), wo er offen sein müsste, ist er verbaut (durch den desaströsen Kopf-
bau des Zwingerforums, der in den Platz hineinstößt wie ein Dolch). Weitere Beispiele sind die Konversion
des ehemaligen Elbbahnhofs in Magdeburg oder das neue Europaviertel in Frankfurt, dessen tote Magistrale
entlang an toten Häusern vom Volksmund "Stalinallee" getauft wurde (wobei zu präzisieren ist: Stalinallee
ohne Stalin, also ohne den repräsentativen Gestus der Straße im Osten Berlins). Das Experiment, einer Stadt,

Stadtverwaldung statt Stadtverschönerung: Europas größte Grünfassade in Düsseldorf © Centrum Gruppe


© 2009-2023 Wolfgang Broemser

Das städtebauliche Unvermögen kommt auch in den Boa-constrictor-breiten Straßen, die unsere Städte
wie Autobahnen durchpflügen, zum Ausdruck: "Eigentlich müssten sie Rückgrate der Stadtentwicklung
sein. Oft sind sie aber nur breite Schneisen durch die Stadt, wo die Bebauung links und rechts eher zufällig
entstanden ist" (Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing). Diese Verkehrswege - Wege nur für den
Verkehr - markieren eine peinliche Unbedarftheit, verglichen mit den Magistralen spanischer oder franzö-
sischer Metropolen, die nicht ein Schlag ins Gesicht der Städte, sondern ein fester Bestandteil des Gesichtes
sind - Schmuck statt Schneise, Booster statt Gap. Die Champs Elysées oder der Paseo de la Castellana sind
zwar verkehrsdurchtost, aber mehr als nur ein Verkehrsraum. Sie sind ein in die Stadt integriertes Gesamt-
kunstwerk, das geliebt und zukunftssicher gemacht wird - wie die Gran Vía in Madrid, von deren sechs Spuren
künftig zwei für Busse und Taxis und zwei für Fahrräder reserviert sein sollen. Der private Autoverkehr wird
aber mitnichten von der Straße verbannt - ein Schicksal, das dagegen dem ehemals schönsten Boulevard von
Berlin blüht. Die Straße "Unter den Linden" war, wie der einzige deutsche Bundespräsident mit Sinn für das
Wahre, Schöne und Gute, Theodor Heuss, schrieb, in der Plangeschichte Berlins das wesentliche Element,
das "die Chance einer großstädtischen Entwicklung phantasiekräftig vorwegnahm". Diese Keimzelle von
Groß-Berlin würde durch die Verwandlung in eine gigantische Fußgängerzone zu einem Symbol grüner
Stadtfeindschaft herabsinken, das nicht dem Klima dient, sondern der Demonstration von Macht.
"Muss ich in meinem Alter noch so rennen..."

Die Bäckerjungen als
Lebensretter?!
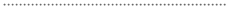
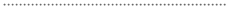
"Ich bin nicht Kaa, ich
bin nur ´ne Autobahn."
die von ihrem baugeschichtlichen Erbe radikal getrennt ist, zu einem gründerzeitlichen Boulevard zu ver-
helfen, ist krachend gescheitert. Auch mit der Königsdisziplin der Stadtplanung, der Gestaltung von Plätzen,
tut sich Deutschlands einzige "Global City" erkennbar schwer - womit sie nicht allein dasteht. In keiner
deutschen Stadt entstand nach dem Krieg ein schöner Platz.
Großstadtluft schnuppern oder: Die Musik spielt
wieder in der Mitte (Teil 1)
wieder in der Mitte (Teil 1)
Spanier und Franzosen haben das Städtebau-Gen - und Deutsche haben es eher nicht. Ein letztes Bei-
spiel: das kürzlich fertiggestellte Einkaufszentrum KII im Zentrum von Düsseldorf, das unter einem Wald von
Hainbuchen begraben liegt (während der Platz dahinter für Skateboarder versiegelt wurde). Hier übermannt
die "gute" Natur die "böse" Stadt, wird Architektur an exponierter Stelle von ökologischem Fundamentalismus
kannibalisiert. Dass der Name der Handelsimmobilie mit dem zweithöchsten Berg der Welt, dem K 2, kokettiert,
ist ein Witz - handelt es sich doch hier um keinen städtebaulichen Gipfel-, sondern Tiefpunkt! In dieser Stadt
haben höchstens die Wagenbauer für den Karneval K 2-Niveau. Grünes Bauen muss Architektur nicht zum
Verschwinden bringen, wie der Bosco Verticale in Mailand oder das Arboretum in Paris, der weltweit größte
Bürocampus aus Holz, zeigen. Oder wie es die politisch sabotierten Entwürfe eines Christoph Langhof gern
zeigen würden, die Schubladen-Schönheiten bleiben, weil sie Öko-Moral und Mut zum architektonischen
Experiment verbinden. Green Building ist großartig, aber nicht, wenn es auf Kosten des Building geht. Öko-
logie und Ästhetik müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Das Nachhaltige lässt uns überleben, das Schöne
lässt uns lieben. Nur wenn das Nachhaltige liebenswert ist, gelingt das Überleben (so wie nur Krankenhäuser,
die Patienten gefallen, beim Heilen helfen).
Sieben Jahre stand das ehemalige Kaufhaus Rupprecht im Herzen der Altstadt leer. Dann
schlug ein Projektentwickler der Stadt die Umwandlung des Gebäudes in ein modernes
Shopping-Center(chen) vor. Ziel war die Wiederbelebung des Zentrums - das Herz sollte
wieder schlagen, die Kassen wieder klingeln, nach Möglichkeit in allen Geschäften der
Innenstadt. Eine Investorengemeinschaft unter Leitung des Generalunternehmers steckte
zwölf Millionen Euro in die Revitalisierung. Nach einjährigem Umbau wurde die neue
Stadthausgalerie eröffnet - für manche Andernacher, die jahrelang die Wiederbelebung
der innerstädtischen Brache herbeigesehnt hatten, ein Gefühl, als fielen Weihnachten und
Ostern zusammen.
Kleine Stadt ganz (gerne-)groß
Die von einem Düsseldorfer Architektenbüro entworfene Passage verpasste der Altstadt
ein Facelifting der Extraklasse. Das Gebäude des ehemaligen Warenhauses wurde entkernt,
die Rohbausubstanz an die neue Nutzung als Einkaufszentrum angepasst. Eine lichtdurch-
flutete Mall verbindet nun Hochstraße und Hügelchen miteinander und zaubert Großstadt-
Feeling in die 30.000-Einwohner-Stadt. Zwölf Läden teilen sich eine Verkaufsfläche von
gerade einmal 4.600 Quadratmetern. In das Obergeschoss der Galerie zogen ein Mehr-
generationenhaus/Haus der Familie, die Volkshochschule, das Sozialamt und die städti-
sche Wirtschaftsförderung ein.
Der ansässige Handel spekulierte...
Für den Oberbürgermeister markierte das Center einen Meilenstein in der Handelsge-
schichte der Stadt: "Andernach ist als Mittelzentrum Vorreiter einer Entwicklung, die heißt:
zurück in die Zentren, die Musik spielt wieder in der Mitte!", sagte er frohlockend bei der
Eröffnung. Der einheimische Handel hatte vor dem neuen Schwergewicht in seiner Mitte
keine Angst - er wollte von der Mall offenbar wie von einer Lokomotive gezogen werden.
Die Galerie werde die Altstadt konkurrenzfähiger gegenüber der "grünen Wiese" machen,
versicherte der Leiter der Händlergemeinschaft. Die neue Konkurrenz des Onlinehandels
erwähnte er nicht. Es beschlich einen der Eindruck, als steckten die Händler den Kopf in
den Sand und als wollten sie von einem (vermeintlichen) Kundenmagneten profitieren,
ohne sich selbst über Gebühr anstrengen zu müssen. Doch Dinos müssen an sich arbeiten,
um nicht auszusterben.
...aber der "Frequenzbringer" bringt es nicht
Inzwischen hat sich längst Ernüchterung eingestellt. Die Mini-Mall zieht die Kunden keines-
wegs magnetisch an - voll war's nur bei der Eröffnung -, sie belebt den innerstädtischen
Handel nicht und hilft keinen Leerstand zu reduzieren. "Architektonisch hui, konzeptionell
pfui", so ließe sich das Malheur umschreiben. Denn das Sortiment schließt keine Lücken,
sondern verdoppelt und verdreifacht nur das im Stadtzentrum schon Vorhandene (Frisör,
Optiker, Boutiquen). In die kleine Galerie wurden zu viele Läden mit kleinflächigem Handel
gepresst, wie er in der mittelalterlichen Altstadt schon existiert. Daraus erklärt sich die
einseitige Mieterstruktur der Mall. Stimmt aber der Branchenmix nicht, kann man nicht der
ausbleibenden Kundschaft den schwarzen Peter zuschieben. Problematisch ist zudem, dass
die Läden im Shopping-Center verschwinden, keinen eigenen Eingang zur Straße haben wie
ihre Konkurrenz außerhalb des Centers. Bei Shopping-Centern auf der "grünen Wiese" stellt
sich das Problem nicht, da hier die innerstädtische Konkurrenz fehlt.
Mauerblümchen statt Magnet
Was man in der Galerie schmerzlich vermisst, ist ein Lebensmittelmarkt - doch der braucht
Platz. Den hätte man schaffen können, wenn man die Zahl der Läden begrenzt hätte*. Ein
Vollsortimenter und ein Textilhändler als Ankermieter hätten Nahversorgungszentrum und
Fashion Mall ideal miteinander kombiniert. Der Supermarkt hätte eine Lücke in der Altstadt
geschlossen und wäre wegen der Fokussierung auf Artikel des täglichen Bedarfs gegenüber
dem Onlinebereich konkurrenzfähig gewesen. Stattdessen hat sich am Hügelchen ein Mauer-
blümchen entwickelt, das nur durch die Zahlungen der städtischen Mieter im Obergeschoss
vor dem Absaufen bewahrt wird. Die Stadt bzw. der Steuerzahler alimentiert einen Einzel-
handels-Zombie im Herzen der Stadt, obwohl der als Herzschrittmacher versagt.
*) Normalerweise erhöht sich die Rentabilität eines Einkaufszentrums mit der Zahl der Läden - doch bei der
Stadthausgalerie ist eher das Gegenteil der Fall. Die Kleinheit der Shopping-Mall wollte der Entwickler durch
eine zu große Zahl von (kleinen) Geschäften kompensieren, die aber nicht überleben können, wenn die
Besucherfrequenz nicht stimmt.
Was passiert mit einem darbenden
Shopping-Center? Es wird an die
Stadt vertickt, in der es steht.
Immerhin war der Preis für die
Stadthausgalerie günstig, heißt es
aus dem Rathaus. Andernach als
unverhoffter Einzelhandelsinvestor
zahlt jetzt selbst keine Miete mehr,
kassiert stattdessen Miete von den
verbliebenen Händlern. Und will
zum Zweck der kardiopulmonalen
Wiederbelebung Unternehmen aus
der Region statt Filialisten in das
Objekt locken. Mit Erfolg: Ein vor-
her in der Bahnhofstraße ansässiges
Sanitätshaus und ein Concept Store
für Baby- und Kinderartikel sind
inzwischen eingezogen. Außerdem
plant die Stadt Pop-up-Stores für
junge Gründer und Kreative sowie
eine konsumfreie Begegnungsstätte
für Jugendliche. Allerdings sorgt das
nur für kurzfristige Einnahmen,
müssen immer wieder neue Mieter
akquiriert werden. Auch warnen
(nicht nur) die Freien Wähler vor
zusätzlichen Kosten durch Auflagen
für energetische Sanierung...
"Wir liefern ins Haus, schwebend,
staufrei, am gleichen Tag!"
"Das ist ja elefantastisch, nein, tuffigantisch!"






The staring dead
Das mobile Internet via Smartphone
macht aus dem Menschen, dem
"geselligen Tier", einen ungeselligen
Zombie. Sein Motto: Analog kann
mich mal! Umgekehrt (digital kann
mich mal!) wär's besser, auch, um
dem Fluch der Selbstvergessenheit
zu entgehen.